… sagte ich, wenn ich an die Reihe kam. Sechzehn. Ursprünglich Schilddrüse, aber mit umfänglichen und hartnäckigen Metastasen in der Lunge. Und es geht mir ganz gut heute.
 Es war ein Mittwoch Nachmittag, ich wollte nur mal kurz reinlesen. Und dann war es auf einmal Abendbrotzeit und ich war schon bei der Hälfte angelangt. Ich weiß nicht, wie ich dieses Buch beschreiben soll. Mitgenommen habe ich es wegen seinem Titel, und ein paar Stunden zuvor habe ich den „Bestseller 2012“-Aufkleber am oberen Buchrrücken angebracht, muss also ganz gut sein.
Es war ein Mittwoch Nachmittag, ich wollte nur mal kurz reinlesen. Und dann war es auf einmal Abendbrotzeit und ich war schon bei der Hälfte angelangt. Ich weiß nicht, wie ich dieses Buch beschreiben soll. Mitgenommen habe ich es wegen seinem Titel, und ein paar Stunden zuvor habe ich den „Bestseller 2012“-Aufkleber am oberen Buchrrücken angebracht, muss also ganz gut sein.
Es ist ein Buch, bei dem man gar nicht mehr aufhören kann. Es hat mich mitgenommen, ich habe Hazel in ihrem Alltag begleitet, ihre Gedanken und Gefühle miterlebt. John Green schreibt zum einen nachdenklich und man hat Mitleid mit dieser jungen Frau, doch im gleichen Moment muss man Schmunzeln und merkt gar nicht, wie bizarr die ganze Sache ist. Hazel beschreibt ihren Krebs z. B. so: Mit dreizehn die Diagnose Schilddrüsenkrebs, Stadium IV. (Ich erzählte ihm nicht, dass die Diagnose genau drei Monate nach meiner ersten Periode kam. So in etwa: Herzlichen Glückwunsch! Du bist eine Frau. Und jetzt stirb.) Der Krebs sei unheilbar, sagte man uns.
Ich möchte nachfolgend noch zwei Textstellen aufführen, die ich sehr berührend fand:
Hazel saß in einem Einkaufscenter und las.
„Ich war so gut wie am Ende, als ein kleines Mädchen mit Zöpfen und Haarspangen vor mir auftauchte und mich fragte: „Was hast du da in der Nase?“
Und ich sagte: „Das ist ein Sauerstoffschlauch. Der versorgt mich mit Sauerstoff und hilft mir beim Atmen.“ Im nächsten Moment war ihre Mutter da und rief mahnend: „Jackie“, aber ich sagte: „Nein, nein, schon gut“, weil es überhaupt kein Problem für mich war, und Jackie fragte: „Kann es mir auch beim Atmen helfen?“
„Ich weiß es nicht“, sagte ich. „Probieren wir es aus.“ Ich nahm den Schlauch ab und ließ Jackie sich die beiden Stöpsel in die Nase stecken und atmen. „Es kitzelt“, sagte sie.
„Ja, oder?“
„Ich glaube, ich kann schon besser atmen“, sagte sie.
„Wirklich?“
„Ja.“
„Ich wünschte, ich könnte dir meinen Sauerstoffschlauch schenken“, sagte ich, „aber ich brauche wirklich seine Hilfe.“ Ich spürte den Sauerstoffmangel bereits. Ich konzentrierte mich aufs Atmen, bis Jackie mir die Schläuche zurückgab. Dann wischte ich einmal kurz mit dem T-Shirt darüber, flocht mir die Schläuche hinter die Ohren und steckte mir die Stöpsel in die Nasenllöcher.
„Danke, dass ich probieren durfte.“, sagte sie.
„Gern geschehen.“
„Jackie“, sagte ihre Mutter wieder, und diesmal ließ ich sie gehen.“
Nachts schläft sie immer mit einem Gerät namens BiPAP.
Das BiPAP nahm mir die Kontrolle über das Atmen ab, was extrem unangenehm war, aber das Schöne waren die Geräusche, die es dabei machte: bei jedem Einatmen rumpelte es, und es zischte, wenn ich ausatmete. Ich fand, dass es wie ein Drache klang, der im gleichen Rhythmus atmete wie ich, als hätte ich einen zahmen Drachen, der sich neben mir eingekuschelt hattte und dem so viel an mir lag, dass er seinen Atem auf meinen einstellte. Daran dachte ich, als ich einschlief.
Ich kann das Buch nur jedem ans Herz legen, lest es und ihr werdet genauso sprachlos und berührt sein. Ich lebe immer noch in der Welt von Hazel, obwohl ich schon ein ganz anderes Buch lese.
Ich spiele auch mit dem Gedanken mir das Buch privat zuzulegen.
John Green, great job!
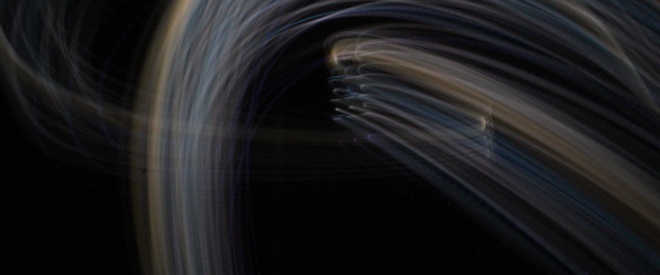 „Natürlich bin ich nach wie vor besessen davon allein zu sein. Kein Dialog ist aufrichtiger oder verlogener als der mit sich selbst. Und einsam in einer Wohnung zu sitzen ist so viel unkomplizierter, als unter Menschen zu sein, die essen und trinken und lachen und so sehr am Leben sind, dass ihr Anblick schmerzt.“
„Natürlich bin ich nach wie vor besessen davon allein zu sein. Kein Dialog ist aufrichtiger oder verlogener als der mit sich selbst. Und einsam in einer Wohnung zu sitzen ist so viel unkomplizierter, als unter Menschen zu sein, die essen und trinken und lachen und so sehr am Leben sind, dass ihr Anblick schmerzt.“

